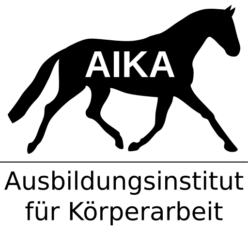Das Equine Metabolische Syndrom (EMS) ist eine Stoffwechselerkrankung bei Pferden, die durch folgende Hauptmerkmale gekennzeichnet ist:
- Insulin-Dysregulation (Insulinresistenz) – Das Pferd reagiert schlechter auf Insulin, wodurch der Blutzuckerspiegel erhöht bleibt.
- Fettleibigkeit oder Fettpolster – Besonders an typischen Stellen wie Mähnenkamm, Schweifansatz und hinter den Schultern.
- Erhöhtes Entzündungsrisiko der Blutgefäße – Besonders erhöhtes Hufreherisiko

Insulinresistenz beim Pferd: Ursachen, Symptome und Behandlung
Die Insulinresistenz ist eine weit verbreitete Stoffwechselstörung bei Pferden, die unbehandelt zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen kann.
Sie ist eng mit EMS verbunden, weil alle Pferde mit EMS eine Insulinresistenz aufweisen. EMS umfasst allerdings neben der Insulinresistenz auch typische Fettpolster (besonders am Mähnenkamm, hinter der Schulter, auf der Kruppe und über den Augen) sowie ein erhöhtes Entzündungsrisiko der Blutgefäße (welche unter anderem für Hufrehe verantwortlich sind).
Ein Pferd kann jedoch auch insulinresistent sein, ohne alle Merkmale des EMS zu zeigen. Manche insulinresistenten Pferde sind nicht übergewichtig, sondern normalgewichtig oder sogar dünn – insbesondere, wenn sie z. B. aufgrund anderer Erkrankungen oder Trainingsfaktoren nicht zu Fettpolstern neigen.
Was ist Insulinresistenz?
Insulin ist ein Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse produziert wird und eine zentrale Rolle im Zuckerstoffwechsel spielt. Es sorgt dafür, dass Glukose aus dem Blut in die Zellen aufgenommen wird. Bei insulinresistenten Pferden reagieren die Körperzellen jedoch nicht mehr ausreichend auf Insulin. Die Bauchspeicheldrüse produziert daraufhin vermehrt Insulin, was zu dauerhaft erhöhten Insulinwerten (Hyperinsulinämie) führt.
Ursachen und Symptome der Insulinresistenz
Die Hauptursachen für Insulinresistenz beim Pferd sind:
• Übergewicht und falsche Ernährung:
Eine kalorienreiche Fütterung mit viel Zucker und Stärke kann Insulinresistenz begünstigen.
• Genetische Veranlagung:
Besonders leichtfuttrige Rassen wie Ponys, Iberer und Kaltblüter sind häufiger betroffen.
• Mangelnde Bewegung:
Ein inaktiver Lebensstil trägt zur Entstehung der Insulinresistenz bei.
• Stress:
Chronischer Stress erhöht den Cortisolspiegel, was die Insulinwirkung negativ beeinflussen kann. Cushing (auch als PPID – Pituitary Pars Intermedia Dysfunction – bekannt) kann die Insulinresistenz verschlimmern, weil es mit einer erhöhten Cortisolproduktion einhergeht. Das überschüssige Cortisol fördert den Abbau von Muskelgewebe, erhöht den Blutzuckerspiegel und verschlechtert die Insulinsensitivität der Zellen. Dadurch kann ein Pferd mit Cushing auch eine Insulinresistenz entwickeln, selbst wenn es nicht übergewichtig ist.
• Veränderungen im Fellwachstum, oft mit verlängertem Fellwechsel:
Aufgrund der nicht mehr effizienten Verwertung von Glukose fehlt den Zellen die Energie für die Stoffwechselprozesse – darunter auch für das Wachstum und den Wechsel des Fells.
Warum erhöht EMS / Insulinresistenz das Hufreherisiko bzw. Entzündungen?
EMS erhöht das Hufreherisiko vor allem durch die Hyperinsulinämie (zu hohe Konzentration von Insulin im Blut). Ein dauerhaft erhöhter Insulinspiegel kann zu einer Dysregulation der Blutgefäße im Huf führen. Dies führt zu einer verminderten Durchblutung und einer erhöhten Gefäßpermeabilität (Durchlässigkeit), wodurch Entzündungen entstehen und die empfindliche Huflederhaut geschädigt wird. Die Hyperinsulinämie wirkt sich nicht nur auf die Blutgefäße in den Hufen aus. Sie kann auch an anderen Stellen des Körpers Probleme verursachen, insbesondere:
• Verminderte Durchblutung in anderen Geweben:
Insulin beeinflusst die Regulation der Blutgefäße im gesamten Körper. Eine anhaltend hohe Insulinkonzentration kann zu Gefäßverengungen führen, die die Durchblutung von Muskeln und Organen beeinträchtigen.
• Erhöhtes Risiko für Entzündungen:
Insulinresistenz steht in Verbindung mit chronischen Entzündungsprozessen, die nicht nur die Hufe, sondern auch andere Gewebe wie Gelenke und Organe betreffen können.
• Veränderte Funktion der Leber:
Die Leber spielt eine Schlüsselrolle im Zuckerstoffwechsel. Durch eine dauerhaft erhöhte Insulinausschüttung kann es zu einer Fetteinlagerung in der Leber kommen (hepatische Lipidose), was die Organfunktion beeinträchtigen kann.
Cortisol, Insulin und der Teufelskreis der Insulinresistenz
Ein hoher Cortisolspiegel führt dazu, dass der Körper vermehrt Glukose ins Blut abgibt, um Energie für eine potenzielle „Kampf-oder-Flucht“-Reaktion bereitzustellen. Dadurch steigt der Blutzuckerspiegel, was wiederum die Bauchspeicheldrüse dazu veranlasst, mehr Insulin zu produzieren. Bei insulinresistenten Pferden wird diese Glukose jedoch nicht effizient in die Zellen aufgenommen, sodass der Insulinspiegel weiter steigt.
Gleichzeitig kann (chronischer) Stress den Cortisolspiegel noch weiter erhöhen, wodurch ein Teufelskreis entsteht:
Mehr Cortisol → mehr Blutzucker → mehr Insulin → verstärkte Insulinresistenz → noch mehr Stress und Cortisol. Dies erhöht letztendlich das Risiko für Stoffwechselstörungen wie EMS.
Diagnose
Die Diagnose der Insulinresistenz erfolgt durch verschiedene Bluttests:
• Messung des Nüchtern-Insulinspiegels
• Glukosetoleranztest zur Beurteilung der Insulinantwort auf Zucker
• Oraler Zucker-Stimulationstest, um die Insulinausschüttung nach Zuckeraufnahme zu prüfen
Behandlung und Management
Eine frühzeitige und konsequente Behandlung kann helfen, die Insulinresistenz zu kontrollieren und Komplikationen zu vermeiden.
1. Ernährung anpassen
• Reduktion von Zucker und Stärke: Getreidehaltige Futtermittel sollten vermieden werden.
• Heu mit niedrigem Zuckergehalt: Heu kann gewässert werden, um überschüssigen Zucker zu reduzieren.
• Raufutterbasierte Fütterung: Eine angepasste Heuration ohne übermäßige Kalorienzufuhr ist essenziell.
2. Bewegung fördern
Regelmäßige Bewegung verbessert die Insulinsensitivität. Tägliches Training, angepasst an den Gesundheitszustand des Pferdes, ist essenziell.
3. Gewichtskontrolle
Übergewichtige Pferde müssen langsam abnehmen, um Schwankungen des Insulinspiegels zu verhindern.
4. Stress vermeiden
Chronischer Stress kann den Hormonhaushalt negativ beeinflussen. Ein stabiles Umfeld mit ausreichend Sozialkontakt und angepasstem Training ist wichtig.
Fazit:
Übergewicht, Insulinresistenz und die daraus resultierenden Probleme sind ernst zu nehmen und erfordern ein zielgerichtetes Handeln.
Gerne unterstützen wir euch beim Management!